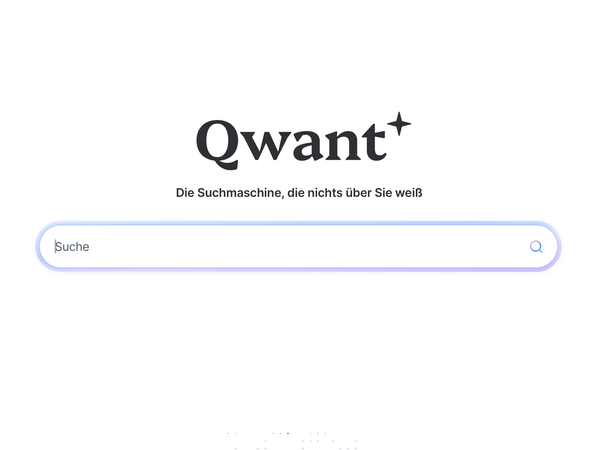Was konkret bedeutet digitale Souveränität?

Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit von Staaten, Organisationen und Unternehmen, ihre digitalen Systeme, Daten und Technologien eigenständig, sicher und unabhängig zu betreiben ohne einseitige Abhängigkeiten von globalen Anbietern. Es geht nicht darum, US-Unternehmen oder andere internationale Player auszuschließen. Es geht um Handlungsfreiheit d.h. die Möglichkeit, jederzeit selbst über den Einsatz digitaler Technologien zu bestimmen.
Digitale Souveränität ist eine strategische Leitlinie und damit Teil des unternehmerischen Risikomanagements. So wie Lieferketten diversifiziert werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müssen auch digitale Wertschöpfungsketten so gestaltet sein, dass geopolitische oder wirtschaftliche Entwicklungen nicht zur unmittelbaren Gefährdung des Geschäftsbetriebs führen.
Praxisbeispiele für digitale Souveränität
Office- und Kollaborationssysteme
Die Abhängigkeit von einem Anbieter wie Microsoft 365 und Co. kann die Handlungsfähigkeit einschränken. Digitale Souveränität bedeutet, Alternativen wie OnlyOffice (mein absoluter Favorit), LibreOffice oder Nextcloud Office einzubeziehen. So wird sichergestellt, dass zentrale Produktivitätsfunktionen nicht an die Preispolitik oder Verfügbarkeit eines einzelnen Konzerns gebunden sind.
E-Mail und Identitätsmanagement
Zentrale Kommunikationssysteme wie E-Mail sollten in souveränen Infrastrukturen betrieben werden. Das heißt: eigene Mailserver oder europäische Hosting-Provider, kombiniert mit föderierten Identitätslösungen auf Basis von offenen Standards (z. B. SAML, OAuth2, OpenID Connect). Wer nur auf Azure Active Directory setzt, begibt sich in ein Lock-in-Szenario. Digitale Souveränität verlangt Alternativen, um auch bei Störungen oder geopolitischen Einschränkungen funktionsfähig zu bleiben.
Cloud-Infrastrukturen und Datenhaltung
Souveräne Cloud-Strategien sind ein Kernelement. Daten mit hohem Schutzbedarf sollten in europäischen Infrastrukturen gespeichert werden, die unter die DSGVO fallen und nicht der Gesetzgebung von Drittstaaten unterliegen. Multi-Cloud-Architekturen, Cloud-Agnostic Deployments und Kubernetes-basierte Orchestrierung ermöglichen, Workloads zwischen Hyperscalern und europäischen Cloud-Anbietern flexibel zu verschieben.
Künstliche Intelligenz
Im KI-Sektor zeigt sich die Notwendigkeit digitaler Souveränität besonders deutlich. Proprietäre Modelle einzelner Anbieter bieten kurzfristig Vorteile, binden Unternehmen aber langfristig in geschlossene Ökosysteme. Der Einsatz von Open-Source-Modellen (z. B. LLaMA, Mistral), die Nutzung europäischer KI-Plattformen und die Möglichkeit, eigene Modelle zu trainieren und zu betreiben, schaffen die Grundlage für echte Unabhängigkeit.
Cybersicherheit und Business Continuity
Digitale Souveränität ist eng verbunden mit Sicherheit. Ein souveräner IT-Betrieb bedeutet, dass Datenhoheit, Zugriffsrechte und Verschlüsselungskontrolle beim Unternehmen selbst liegen. Durch Zero-Trust-Architekturen, Vendor-Risk-Management und klare Exit-Strategien für externe Anbieter wird sichergestellt, dass weder technische Störungen noch geopolitische Entwicklungen die digitale Integrität gefährden.
Keine politische Agenda sondern strategische Notwendigkeit
Die Diskussion über digitale Souveränität ist nicht neu. Spätestens seit der Trump-Administration wird sichtbar, welche Risiken entstehen, wenn ein Land oder ein Anbieter willkürlich über die digitale Handlungsfähigkeit anderer Akteure bestimmt. Sanktionen, geänderte Exportregeln oder einseitige Vertragsänderungen können ganze Branchen in Bedrängnis bringen.
Digitale Souveränität bedeutet nicht „gegen“ andere Länder oder Konzerne zu arbeiten, sondern die eigene Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Es ist ein strategischer Imperativ für Unternehmen, Staaten und Gesellschaften.
Umsetzung: strukturiert und schrittweise
Digitale Souveränität kann nicht mit einem Schlag erreicht werden. Sie entsteht durch einen klaren Transformationspfad:
- Analyse der Abhängigkeiten – Welche Systeme sind kritisch, welche Anbieter dominieren?
- Risikobewertung – Welche Folgen hätte ein Ausfall oder der Entzug von Leistungen?
- Alternativen identifizieren – Welche offenen Standards und souveränen Anbieter gibt es?
- Pilotierung und Migration – Erste Anwendungsfälle schrittweise in souveräne Infrastrukturen überführen.
- Governance etablieren – Souveränität als Prinzip in IT-Strategie und Beschaffungsrichtlinien verankern.
- Management Commitment – Digitale Souveränität ist ein Tone at the Top-Thema, das nur durch klare Führung umgesetzt werden kann.
Fazit
Digitale Souveränität ist sicher keine Fiktion. Sie ist heute bereits mit bestehenden Lösungen umsetzbar. Von alternativen Office-Tools über europäische Cloud-Dienste bis hin zu offenen KI-Modellen, alles ist vorhanden.
Der einfachste Weg in der IT und damit die schnelle Abhängigkeit von einem großen Anbieter ist selten der langfristig sinnvollste. Digitale Souveränität bedeutet, bewusst Verantwortung zu übernehmen und Unabhängigkeit als strategischen Vorteil zu begreifen.
Auch große Unternehmen können ihre digitale Handlungsfreiheit sichern, wenn sie diesen Weg systematisch und in klar definierten Schritten gehen. Zwar ist eine solche Umstellung zweifelsohne mit einem gewissen Initialaufwand verbunden. Sei es durch notwendige Investitionen in alternative Systeme, die Anpassung bestehender Prozesse oder den Aufbau interner Kompetenzen. Doch dieser Aufwand ist strategisch betrachtet eine Investition in Unabhängigkeit und Zukunftsfähigkeit. Wer heute die Weichen in Richtung digitaler Souveränität stellt, reduziert langfristig Abhängigkeiten, gewinnt Flexibilität bei der Wahl von Technologien und Anbietern und stärkt zugleich die eigene Resilienz gegenüber externen Einflüssen.