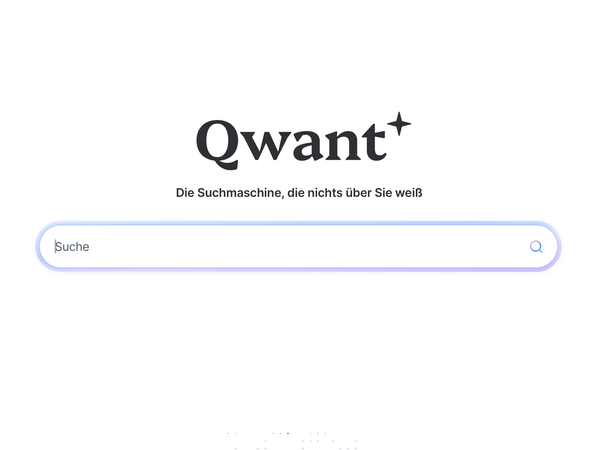Peter Hochegger im Espresso Talk

Wie Korruption funktioniert
Peter Hochegger ist seit Jahrzehnten ein Name, der im österreichischen politischen und wirtschaftlichen Kontext aufhorchen lässt. Zwischen 2000 und 2006 sollen über 40 Millionen Euro an Honoraren und Provisionen über ihn geflossen sein, überwiegend aus staatsnahen Unternehmen wie Telekom Austria und ÖBB. Nutznießer waren politische Entscheidungsträger und Funktionäre fast aller politischen Parteien, gedeckt durch ein Geflecht aus Beratungsverträgen, Netzwerken und Abhängigkeiten.
Im Rahmen der diesjährigen Compliance Now! hatte ich die einmalige Gelegenheit, Hochegger in einem Espresso Talk mit Martin Kreutner zu erleben. Der Austausch bot einen seltenen, ungeschönten Blick auf Funktionsweisen, Mechanismen und Dynamiken politischer Einflussnahme in Österreich. Teils historisch, teils beunruhigend aktuell.
Wie Ausschreibungen gesteuert wurden
Ein erster Punkt seiner Ausführungen war die zielgerichtete Anpassung von Ausschreibungen. Am Beispiel einer geplanten Steuerreform schilderte Hochegger, wie Konzepte vorentwickelt und die Ausschreibung anschließend darauf zugeschnitten wurde. Intern wurde dies als „teleologisch angepasst“ bezeichnet, ein juristischer Euphemismus, der Kritik abfedern sollte.
Die Konsequenz war Wettbewerbsverzerrung zugunsten einzelner Firmen, Schaffung von Abhängigkeiten und eine systematische Verzerrung politischer Entscheidungen durch wirtschaftliche Interessen.
Scheinfirmen, Scheinrechnungen und verschleierte Geldflüsse
Hochegger beschrieb offen, wie Scheinfirmen genutzt wurden, um verdeckte Zahlungen, Kampagnenfinanzierungen und manipulative Maßnahmen zu verschleiern. Selbst Demonstrationen vor Regierungsgebäuden wurden über Scheinrechnungen finanziert vorgeblich als „Grassroots-Bewegungen“ wirkend. Zielsetzung war damals, das zivilgesellschaftliche Engagement strategisch umzulenken: Weg von Aktionen gegen Waffenhersteller, hin zu breiten Umweltthemen. Dadurch sollten die Waffenproduzenten aus dem unmittelbaren öffentlichen Fokus herausgenommen und der gesellschaftliche Druck auf sie nachhaltig abgeschwächt werden.
Abhängigkeiten zwischen Politik, Wirtschaft und Lobbying
Einen Schwerpunkt legte Hochegger in seinem damaligen Wirken auf das Beziehungsgeflecht zwischen Parteien, staatsnahen Betrieben und Lobbyisten. Wahlkämpfe, parteinahe Initiativen oder sogar Fußballclubs wurden über Scheinaufträge und Zahlungen aus staatsnahen Unternehmen finanziert. Diese Unternehmen fungierten als „indirekte Gelddruckmaschinen“.
Hochegger betonte auch die Relevanz persönlicher Loyalitäten: Korruption funktioniere nicht durch Einzelpersonen, sondern durch ein stabiles Netzwerk aus Mitwissern, Nutznießern und Wegschauenden, oft im Geflecht politischer Parteien.
Zweiklassenjustiz und politische Einflussnahme
Am Beispiel von Stefan Wehninger zeigte Hochegger auf, wie politische Einflussnahme Karrieren beendet und institutionelle Entscheidungen verzerrt. Wehinger wurde aus seiner Vorstandsfunktion bei den ÖBB gedrängt, weil er sich der politischen Einflussnahme der damaligen Regierungspartei widersetzte und keine Mittel für verdeckte Parteienfinanzierung freigab.
Trotz bestätigter politischer Interventionen gegen ihn in diesem Fall blieben Konsequenzen weitgehend aus. Diese Ungleichbehandlung verdeutlicht, wie stark Netzwerke gegenüber unabhängigen Akteuren wirken.
Persönliche Wende und Reflexion
Erstaunlich offen sprach Hochegger über seine persönliche Verstrickung und den Wandel während seiner Haftzeit. Der Stolz auf Macht und Einfluss, so seine Worte, habe ihn blind gemacht. Erst im Gefängnis sei er mit den realen Folgen seines Tuns konfrontiert worden. Er vergleicht das System mit einem Frosch im langsam erhitzten Wasser: Ein schleichender Prozess, der erst spät als destruktiv erkannt wird.
Der Ausstieg sei nur durch persönliche Einsicht möglich gewesen, unterstützt durch seine Familie. Gleichzeitig zeigte er auf, wie schwer ein wirklicher Bruch mit einem System fällt, das auf Loyalitäten, gegenseitigen Gefallen und familiären Bindungen basiert.
Compliance im Realitätscheck
Ein kritischer Punkt war Hocheggers Bewertung aktueller Compliance-Systeme. Viele seien gut gemeint, aber strukturell wirkungslos. Codes of Conduct und Policies hätten häufig nur kosmetischen Charakter, solange Zielsysteme, Anreizmodelle und Machtstrukturen unverändert bleiben.
Für nachhaltige Integrität brauche es:
- andere Zielsetzungen (weg von reiner Gewinnorientierung),
- eine echte Fehler- und Lernkultur,
- klare Trennung von politischen und wirtschaftlichen Interessen,
- transparentere Governance-Strukturen.
Persönliche Zukunft und rechtlicher Status
Hochegger steht weiterhin unter Beobachtung der Justiz. Der OGH bestätigte eine dreijährige Haftstrafe, davon ein Jahr unbedingt. Er hat einen Antrag auf elektronische Fußfessel gestellt; eine Entscheidung wird innerhalb von sechs Monaten erwartet. Sollte diese nicht bewilligt werden, plant er die Rückkehr in den Strafvollzug und die Arbeit an einem weiteren Buch.
Hochegger positioniert sich als kritischer Beobachter eines Systems, dessen Teil er einst war.
Mein Fazit dieses Talks
Der Espresso Talk bot einen selten unmittelbaren Blick hinter die Fassaden österreichischer Politik- und Lobbylandschaften. Die Schilderungen machten für mich deutlich, dass Korruption nicht primär aus Einzelfällen entsteht, sondern aus gewachsenen Strukturen, Abhängigkeiten und Anreizsystemen. Für Compliance-Verantwortliche sollte dies ein wertvoller Realitätscheck sein:
- Wirkung entsteht nur durch Kultur und klare Governance.
- Strukturen müssen Transparenz belohnen, nicht Loyalität.
- Integrität braucht persönliche Haltung, nicht nur Regelwerke.
Ein Gespräch, das mir eindringlich gezeigt hat, warum funktionierende Compliance weit über Policies hinausgeht und warum wir als Governance-Community weiter am Ausbau systemischen Lösungen arbeiten müssen.