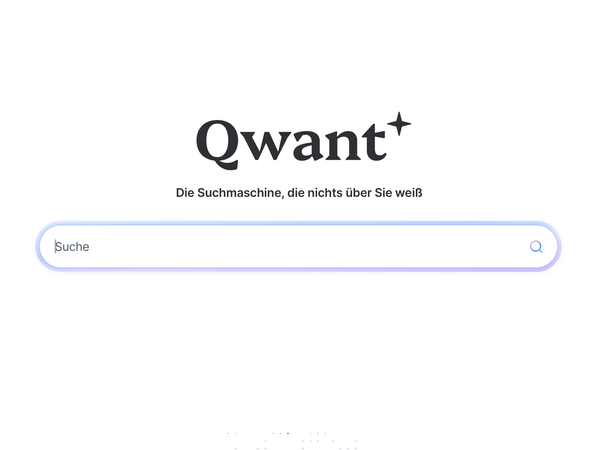Europas Rückwärtsgang beim Verbrenner-Aus

Meinung: Während Europa eigentlich vor der gewaltigen Aufgabe steht, seine Industrie in eine klimaverträgliche Zukunft zu führen, beschäftigt sich die politische Debatte erneut mit Rückschritten, die wie aus einer anderen Zeit wirken. Die jüngsten deutschen Vorstöße, das europaweit bereits vereinbarte Auslaufen von Verbrennungsmotoren zu verwässern, markieren dabei einen Tiefpunkt:
Statt Planungssicherheit zu gewährleisten und Investitionen in zukunftsfähige Technologien zu fördern, wird der Reformprozess mutwillig verlangsamt und mit technischen Scheinlösungen überfrachtet.
Die EU-Kommission sieht sich nun also gezwungen, Vorschläge zu prüfen, die im Kern darauf abzielen, den ohnehin knappen Zeithorizont für die Transformation weiter auszudehnen.
Die Forderung, nach 2035 weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, ob als Plug-in-Hybrid, Range-Extender oder sogenannter „hocheffizienter Verbrenner“, zuzulassen, führt faktisch zu einer Fortsetzung jenes Technologiepfads, der Europa erst in die aktuelle Abhängigkeit von fossilen Energieträgern gebracht hat.
Die bekannten Probleme dieser Übergangstechnologien werden damit ignoriert:
- geringe Realemissionsreduktion
- hohe Komplexität
- fragwürdige Wirksamkeit
- ein massives Risiko, die Elektromobilität strukturell auszubremsen.
Die politische Rhetorik der „Technologieoffenheit“ dient in diesem Kontext eher als Schutzschild für die Verlängerung des Status quo denn als ernsthafte industriepolitische Vision.
Während die Weltmärkte längst klare Signale Richtung emissionsfreier Mobilität senden und Wettbewerber Milliarden in die Elektrifizierung investieren, riskiert Europa durch kleinteilige Ausnahmen und nationale Sonderwege den Verlust seiner technologischen Führungsrolle.
Die EU-Kommission arbeitet parallel an einer Überarbeitung der CO2-Flottengrenzwerte und erhält umfangreiche Rückmeldungen aus allen Mitgliedstaaten. Anstatt diesen Prozess mit strategischer Weitsicht zu unterstützen, tragen nationale Vorstöße wie jener aus Deutschland zur Verwirrung und Unsicherheit bei. Sie unterminieren bereits getroffene Beschlüsse und erschweren eine konsistente Regulierung.
Unterm Strich entsteht ein Bild von politischem Kleinmut: Entscheidungen werden unter dem Deckmantel vermeintlicher Flexibilität aufgeweicht, obwohl die wissenschaftlichen und ökonomischen Argumente längst klar in Richtung eines zügigen Ausstiegs aus dem Verbrennungsmotor zeigen. Jede weitere Verzögerung erhöht die Kosten, verlängert Abhängigkeiten und schwächt die europäische Industrie im globalen Wettbewerb.